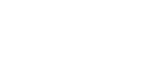Weit ausladend führte das Tal hoch zum Morina-Pass. Drüben lag bereits Albanien. Die Gipfel der über 2000 Meter hohen Berge rechts und links zeigten sich weiß angehaucht , es war Oktober, der Winter nahte. Im Tal weideten die Kühe. Eine friedliche Idylle. Verliefe nicht unmittelbar an jeder Straßenseite dieses schmale, gelbe Band.
MINE! Stand in regelmäßigen Abständen in schwarzer Schrift darauf.
Die Straße war eng. Sie wurde nicht viel genutzt. Bei Gegenverkehr musste in den Graben ausgewichen werden bis die Fahrzeuge fast das gelbe Band streiften. Die beiden Geländewagen „Wolf“ der Bundeswehr nahmen den größeren Bogen, die vorbeifahrenden Kosovaren grüßten freundlich und winkten. Sie gaben sich Mühe, ihre Freude über das fremde Militär im Land auch deutlich genug zu zeigen. Fahrt bloß nicht wieder weg, hieß das. Die Soldaten nickten zum Zeichen, dass sie den Wunsch verstanden hatten.
Das Absperrband ließ auf der linken Straßenseite plötzlich eine kleine Öffnung, und ein markierter Weg führte auf das Weideland. Wir waren schon ein Stück daran vorbei, als sich ein Minenräumkommando zeigte. In dicken Schutzwesten, das Gesicht hinter Plexiglas geschützt, konzentrierten sich die Soldaten bei jedem Schritt vorwärts auf die Signale der vor sich gehaltenen Sonden. Ich begehrte anzuhalten. Mit zwei anderen Journalisten stieg ich aus, die Kamera griffbereit. Ohne Teleobjektiv lohnte sich das Fotografieren jedoch nicht, die Minenräumer standen zu weit entfernt für ein Bild, das die Chance zur Veröffentlichung bekommen wollte.
Unsere Begleitung stieg jetzt auch aus den Fahrzeugen. Die Sonne kam gerade durch die Wolken und wärmte angenehm. Wir standen in Grüppchen und schwatzten. Dieser Auflauf in der sonst weithin menschenleeren Gegend weckte die Neugierde der weidenden Kühe auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sie kamen dicht an uns heran bis unmittelbar an das Absperrband, als wollten sie Neuigkeiten erfahren.
Mir war nicht wohl dabei. Denn die Kühe liefen mitten durch das Minenfeld. Der Hauptfeldwebel neben mir gab sich jedoch gelassen: „Die werden hier schon wissen, wo sie ihre Viecher laufen lassen. Vielleicht sind ja auch diejenigen noch im Dorf, die einst die Minen gelegt haben“, wehrte er meine Bedenken ab. Und um mich weiter zu beruhigen, zeigte er auf mehrere Erdlöcher, die sich im Abstand von zehn Metern rechts von der Straße weg in das Tal hinein zogen: „Was dort gefunden wurde, waren alles nur Panzerminen.“
„Nur Panzerminen?“, fachsimpelte ich mit einem meiner Kollegen. Beide waren wir uns einig, dass ein Druck von fünfzig Kilogramm ausreicht, und das Ding geht hoch. „Sie soll nicht bei jedem Feldhasen explodieren, aber wenn etwas mit dem Gewicht einer Kuh. . .“
Wir hätten es nicht herbeireden sollen.
Im selben Moment fuhr ein Blitz in die Höhe, und in den Ohren dröhnte ein fürchterlicher Schlag. Die Soldaten warfen sich sofort flach auf die Straße. Einer von ihnen hatte eine Journalistin, die unmittelbar neben ihm stand, mit zu Boden gerissen und sie heldenhaft mit seinem Körper bedeckt. Meine Militärausbildung lag offensichtlich zu weit zurück, um das Nächstliegende zu tun. Mit keiner Faser mehr war ich mir der Gefahr durch Splitter bewusst, sondern zog lediglich den Kopf ein und kniff die Augen zusammen, weil ich fürchtete, von einer Rippe, einem Horn oder Huf des zerfetzten Tieres getroffen zu werden. Es regnete aber lediglich von oben kleinere, aus der Weide herausgerissene Erdklumpen. Vor uns in der Luft stand mehr als zehn Meter hoch eine Fontäne aus Explosionsrauch und Staub, die der Wind schnell mit sich wegzog. Es hatten sich schon wieder alle aufgerappelt, als ich zumindest noch ein Foto von der abwandernden Rauchwolke schoss. Etwas verlegen bedankte sich die Journalistin. Ich versuchte mir vorzustellen, wie mir wohl zumute gewesen wäre, wenn ich urplötzlich auf offener Straße unter einem Soldaten gelegen hätte.
Wir waren uns allesamt bewusst, mächtiges Glück gehabt zu haben, dass uns tatsächlich „nur“ eine Panzermine um die Ohren geflogen war. Denn deren Vernichtungskraft richtet sich konzentriert gegen die erwartete Panzerung direkt über ihr. Bei einer Personenmine, die einen tödlichen Splitterregen um sich verteilt, wären wir nicht so glimpflich davon gekommen. Auch die Kuh hatte es längst nicht so zerrissen, wie ich eigentlich erwartet hatte. Man sah ihr keine äußerliche Verletzung an, es floss kein Blut. Sie lag, als würde sie nur schlafen. Die anderen Tiere kamen allesamt zu ihr, schnüffelten an ihr und stubsten sie mit dem Maul an. Steh doch wieder auf, schien das zu heißen.
Natürlich wollten wir schleunigst weg . Aber das ging nicht. Die Fahrzeuge standen unmittelbar vor dieser Herde, die aufgeregt hin und her trampelte. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis sie die nächste Mine fanden. Wir versuchten, mit kleinen Steinchen vom Straßenrand die Kühe zu vertreiben. Wo immer so ein Steinchen hinfiel, dorthin lief sofort auch eines der Tiere, als würden wir ihnen Leckerli zuwerfen. Zu Fuß gab es ebenso kein Entkommen. Die Rindviecher folgten uns und liefen parallel mit uns weiter durch das Minenfeld. Zur anderen Seite konnten wir auch nicht weg, dort spannte sich Achtung gebietend jenes gelbe Band, hinter dem das Räumkommando mitten in der Arbeit steckte.
Eine Kuh hat auf eine Panzermine getreten.
Auf der äußerst schmalen Straße blieb uns nichts anderes übrig, als nervös von einem Bein auf das andere tretend darauf zu warten, dass die Tiere von allein abziehen und wir das Glück mit ihnen teilen, dass sie nicht nochmals auf einen Zünder treten.
Nach geraumer Zeit gesellte sich ein Junge von vielleicht zehn Jahren zu uns. Niemand hatte gesehen, woher er auf einmal kam. Er versuchte die gleiche Methode mit den Steinchen, und wir rieten ihm schleunigst, dies zu unterlassen. Er sah sehr verzweifelt aus. Viel Fantasie bedurfte es nicht zu erraten, dass es offenkundig seine Aufgabe war, darauf aufzupassen, dass die Herde nicht ins Minenfeld läuft. Vielleicht war er eingeschlafen oder völlig ins Spielen vertieft gewesen. Mit nach beiden Seiten weit ausgebreiteten Armen und lauten Rufen auf sie zurennend unternahm er noch einen Versuch, die Tiere von hier zu verscheuchen. Sie schauten ihn nur verständnislos an, mit ihren feucht glänzenden großen Augen.
Auf der Straße näherte sich ein Mann. Er kam in Gummistiefeln, sah ziemlich abgekämpft aus und musste wohl schon ein Stück gerannt sein, bis er erschöpft in einen langsameren Trott verfiel. Er rang nach Luft. Entsprechend kurz fiel der Dialog mit dem Jungen aus. Ohne Umschweife drückte er das gespannte Band mit der Minenwarnung nach unten und überstieg es. Fassungslos riefen wir ihn zurück. Aber ohne sich um uns zu scheren, trieb er die Kühe zusammen und schräg zur Straße vor sich her. Sobald eines der Tiere aus der Herde auszubrechen versuchte, umkreiste er sie wie ein Schäferhund und lauten Rufen. Er sparte nicht mit Schritten. Jeder andere wäre wie auf Stelzen gestakt, immer auf der Suche nach der kürzesten Entfernung, immer in höchster Anspannung, bevor er seinen Fuß aufsetzt. Diesem Mann ging es nicht um sein Leben, sondern das der Kühe.
Von uns sprach niemand mehr ein Wort. Alle hielten den Atem an in Erwartung einer Katastrophe. Die Kamera hatte ich mir zuvor um den Hals gehängt. Wenn ich das Foto haben wollte, von dem schrecklichen Moment, in dem ein Mensch auf eine Mine tritt und er eingeschlossen in einen Lichtblitz von der Explosion nach oben oder zur Seite geschleudert wird, dann müsste ich jetzt mit dem Fotoapparat praktisch auf ihn anlegen, um ohne Verzug auf den Auslöser drücken zu können. Dieses Foto wäre eines von jenen, das bei jeder internationalen Ausstellung Preise eingebracht hätte, um das womöglich Zeitschriften wie „Newsweek“ mit hohem Honorarangebot förmlich betteln würden. Aber darf man regelrecht auf den Tod warten? Ist das übelste Sensationsgier?
Nein, sagte ich mir, das ist es nicht. Ein Journalist darf nicht nur, er muss. Das Massaker von My Lai im Vietnamkrieg wäre nie bekannt geworden, hätte nicht ein Reporter gefilmt. Die Öffentlichkeit fährt immer erst dann empört auf und gebietet Einhalt, sobald sie Bilder von den Schrecken sieht. Beim Völkermord in Ruanda 1994 waren keine Kameras dabei, monatelang tobten sich die Killer ungestört aus. Auch vom Verbrechen der Minenleger im Kosovo zeugten bislang nur Opferzahlen. Bilder sprechen sofort eine andere, eine weit überzeugendere Sprache als die beste Reportage oder die ehrlichste Opferstatistik.
Aus den Augenwinkeln sah ich nach meinen Kollegen. Sie hielten ihre Kamera ebenso wie ich vor der Brust und nicht im Anschlag. Durch ihren Kopf, davon war ich fest überzeugt, gingen jetzt dieselben Gedanken wie bei mir. Wir haben uns am Abend noch lange über diesen Tag unterhalten, doch keiner sprach diese Minuten an, in denen wir den wahnwitzigen Weg des Kosovaren durch die Minen verfolgten. Jeder behielt lieber die Kalkulationen des eigenen Erfolgs und den dafür von einem anderen zu zahlenden Preis für sich. Hätte einer den Fotoapparat auf Augenhöhe gebracht, es wäre das Signal für uns alle gewesen. Aber etwas hatte uns zurückgehalten. Jeden einzelnen.
Der Bauer war inzwischen nur noch als kleiner Punkt wahrnehmbar. Er brachte die Herde ohne weitere Verluste zurück. Dennoch konnte ich nicht nachvollziehen, warum jemand sein Leben riskierte für ein paar Kühe. Es herrschte schließlich keine Hungersnot im Kosovo.
„Vielleicht war es die Herde des Clanchefs“, versuchte jemand von der Bundeswehrbegleitung eine Erklärung zu finden. „Dann wäre es für die Familie, die den Auftrag zum Hüten hatte, lebensgefährlicher, noch mehr Kühe zu verlieren, als durch die Minen zu laufen.“
Das klang in der Tat plausibel. Ich erinnerte mich an die Anweisung gleich am ersten Tag im Kosovo. „Sollte Ihnen die Ehre zu Teil werden, von einem Clanchef eingeladen zu werden, schlagen Sie nichts ab“, so hieß es. „Selbst das scheinbar harmlose Angebot einer Zigarette kann übel ausgehen, wenn Sie abwinken, auch wenn Sie das damit erklären, Nichtraucher zu sein.“
Man muss das erst verdauen und die Siedlungen der Großfamilien gesehen haben. Mehrere hundert wohnen praktisch unter einem Dach. Die Gehöfte und Stallungen lehnen sich burgartig aneinander an und sind von einer hohen, schützenden Mauer umgeben. Jeder Clan gibt damit zu verstehen, dass er keinerlei Skrupel hat, seine Interessen auch mit Gewalt durchzusetzen und auf Racheakte vorbereitet ist. Der dort herrschende Patriarch macht die Gesetze und bestimmt über alles, die Arbeitseinteilung, die Vergabe des Verdienstes, die Schulzeit der Kinder, die Partnerwahl. Der Einzelne ist hier nichts, auch nicht sein Leben. Wer einen solchen Clanchef herausfordert, ihn womöglich vor seinen Leuten bloßstellt, muss mit allem rechnen. Eine von ihm in einem Anflug von Großmut angebotene Zigarette abzuweisen, könnte ja bedeuten, sie war zu billig oder ihr Besitzer zu schäbig – in jedem Fall also eine gefährliche Beleidigung.