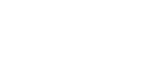Geschichte aus düsteren Zeiten
TA-Redakteur Ingo Linsel über seinen Roman, den Südharz im Dreißigjährigen Krieg und die Fährnisse detailgetreuer Recherchen
Thüringer Allgemeine vom 02. April 2016
Herr Kollege, der Roman ist in einem Ort namens Herrmannsacker angesiedelt. Es gibt ihn wirklich: Nordöstlich von Nordhausen, 365 Seelen bei der letzten Zählung. Gibt es einen persönlichen Bezug?
Eine glückliche Kindheit, die ich dort verbracht habe. Das Dorf ist voller Geschichte. Über der Esse der historischen Schmiede ist noch das Jahr 1740 eingekerbt, nach Untersuchungen im Kernholz der Balken muss sie aber wenigstens 100 Jahre älter sein. Dort wurde also schon in Zeiten des Dreißigjährigen Krieges geschmiedet. Mystische Geschichten gibt es auch, zum Beispiel von der Ruine Ebersburg, deren letzte Bewohner von der Bevölkerung ins Gehölz getrieben wurden, weil sie wohl die Pest hatten.
Zum Sterben in den Wald – ziemlich gnadenlos, die Bewohner von Herrmannsacker!
Ich kann beruhigen, ihre Nachfahren sind allesamt freundliche Menschen. Zur Rechtfertigung muss gesagt werden, dass es die Leute in der Gegend damals wirklich schwer hatten. Die fruchtbaren Böden der Goldenen Aue beginnen erst weiter südlich, die Menschen lebten vornehmlich vom Wald. Ihr Leben war voller Aberglauben und Unwissen. In jedem ungewöhnlichen Sonnenuntergang, jedem Wetterleuchten sahen sie Zeichen von drohendem Unheil, sie fürchteten sich vor Hexen, vor göttlichen Strafen. Bis heute ist ungeklärt, worum es sich bei einer grassierenden Epidemie gehandelt hat, die sie den „Englischen Schweiß“ nannten. Wenn jemand von einer Seuche befallen wurde, trieb man ihn in den Wald aus Angst vor Ansteckungen, oder die Leute nagelten ihnen kurzerhand Türen und Fenster zu.
Und dazu die Söldnertruppen, die wie Heuschreckenschwärme über die Dörfer herfielen. Die Geschichte ist im Dreißigjährigen Krieg angesiedelt. Weil man sich als Journalist einmal von der Tagespolitik erholen will?
Eigentlich hat mich die Tagespolitik auf das Thema gebracht. Ich habe als Journalist während der Balkankriege das Kosovo besucht und Bosnien. Die Grausamkeiten, die sich dort Menschen angetan haben, erinnerten mich an die aus den zurückliegenden Jahrhunderten. Wir bilden uns viel auf unsere zivilisatorische Entwicklung ein, in Wahrheit sind es gar nicht so unermesslich viele Generationen, die uns von der finsteren Vergangenheit trennen. Aber ich wollte nicht nur ein düsteres Kriegsszenario schreiben, sondern einen Roman, der unterhält.
Und das mit viel Begeisterung zum Detail. Zum Beispiel von spionierender Vorhut, die in den Städten die Leute aushorchten, damit die nachrückenden Söldner wussten, wo es etwas zu holen gibt. Wahr oder ausgedacht?
Bei solchen Beschreibungen habe ich mich an das gehalten, was in Chroniken oder von Zeitzeugen überliefert wurde. Davon gibt es eine ganze Menge, zum Beispiel das Tagebuch eines Mühlhäuser Soldaten aus jener Zeit oder Chroniken von Pfarrern und Kantoren. Bei Details wie Kleidung, Münzen, Nahrung oder was die Menschen bei Krankheiten unternahmen, habe ich mich auf historische Quellen gestützt.
Keine Angst vor überkorrekten Heimatforschern und Geschichtslehrern?
Doch! Ich weiß sehr wohl, wie empfindlich Leser bei solchen Fehlern reagieren. Als ich beschrieb, wie meine Helden durch das Rittertor in Stolberg einziehen und beim Blick zum Schloss die Augen mit der Hand vor der Morgensonne schützten, habe ich im Stadtplan nachgeschaut, ob das geografisch überhaupt hinhaut. Bei manchen Szenen muss man höllisch aufpassen. Es geht nichts über einen falsch verorteten Löwenkopf am Stadttor! In Ilfeld bin ich durch die „Lange Wand“ gekrochen um zu sehen, wie damals das Erz gefördert wurde. Ein empfehlenswerter Ausflug übrigens, wer sich für Geschichte interessiert.
Könnten Sie auch einen Angelhaken selber schmieden?
Weil ich das im Roman in einer Szene beschreibe? – Das könnte ich sogar hinbekommen. Als Schüler hatten wir im UTP-Unterricht das „Verformen von Eisen“ geübt. Meine Familie hat direkt neben der Schmiede in Herrmannsacker gewohnt, mit dem Klang des Hammers auf dem Amboss bin ich groß geworden.
Der Roman hat 800 Seiten. Kürzer ging es nicht?
Kürzer wollte ich nicht. Vielleicht ist das ja berufsbedingt. Endlich einmal eine Geschichte schreiben, ohne sich an die Begrenzungen halten zu müssen.
Das Buch reiht sich ein in eine lange Reihe historischer Romane, die Verlage jedes Jahr auf den Markt bringen. Woher rührt eigentlich dieses anhaltende Interesse an der Vergangenheit?
So anhaltend ist dieses Interesse offensichtlich gar nicht mehr, das habe ich mehrfach zu hören bekommen, als ich einen Verlag suchte. Im Übrigen auch, dass es vor allem Frauen sind, die historische Romane lesen. Im Lektorat hat man mir deshalb auch nahegelegt, auf besonders drastische Schilderungen von Brutalitäten besser zu verzichten.
Daran haben Sie sich aber nicht gehalten, es gibt einige sehr detailgetreue Beschreibungen von Folterungen. Wie sind Sie damit durchgekommen?
Immerhin waren von den vier Lektoren, die den Text gelesen haben, drei weiblich. So schlimm kann es also nicht gewesen sein.
Der Autor Peter Prager hat zehn Thesen zum historischen Roman aufgestellt. Unter Punkt acht heißt es: Ein historischer Roman ist ein Gegenwartsroman. Wo steckt bei Ihnen die Gegenwart?
In den Menschen. Man kann vieles aus historischen Überlieferungen übernehmen, aber beim Denken, Fühlen, und Handeln stützt man sich auf heutige Maßstäbe. Als ich das erwähnte Tagebuch des Mühlhäuser Soldaten las, war ich überrascht, in welchem Maße der tägliche Überlebenskampf Denken und Wahrnehmung einschränkt. Für Barmherzigkeit oder gar Romantik blieb da wenig Raum.
Marketenderin mit großen Plänen
Ein kleines Dorf im Südharz mitten in der düsteren Zeit des Dreißigjähriges Krieges. Söldnertruppen überfallen Städte und Dörfer, plündern, vergewaltigen und brandschatzen. Alle Grundregeln menschlichen Miteinanders haben ihre Geltung verloren, altes Handwerk gerät in Vergessenheit, Dörfer verschwinden von der Landkarte, Äcker veröden. Inmitten dieser Dunkelheit träumt die selbstbewusste und umtriebige Maketenderin Frowe von einem sesshaften Leben und einem Handel mit Kupfergeschirr, dessen Material aus den dortigen Erzminen gewonnen wird. Sie gerät dabei in die Fänge von düsterem Aberglauben.
Ingo Linsel: Der Schmied und die Marketenderin, erschienen bei Knaur 2015, 822 Seiten, als Taschenbuch 14,99 Euro, als E-Book 6,99 Euro.
Elena Rauch / 02.04.16

Die uralte Burg Hohnstein bei Neustadt, die im Dreißigjährigen Krieg angesteckt wurde. Foto: Ulrike Dochow

Der Amboss in der historischen Schmiede. Foto: Ulrike Dochow